
Dunkle Wolken ziehen über den Himmel, Orkantief Sabine kündigt sich an diesem regnerischen Februarvormitttag schon an. Wir sind auf dem Weg zur Stiftung Jugendhilfe aktiv in Esslingen, um Martin Auerbach zu treffen, der dort als Krisenmanager arbeitet. Das weitläufige Gelände der gemeinnützigen kirchlichen Stiftung der Diakonie Württemberg liegt auf einer Anhöhe mit Blick über die alte Burg hinweg auf die Stadt. In mehreren Gebäuden sind Wohngruppen und Mutter-Kind-Wohnungen untergebracht, es gibt eine eigene Schule, eine große Turnhalle, Spielplatz und Sportplatz – ein Ort zum Wohlfühlen für Kinder und Jugendliche.
Das Herzstück des Geländes ist ein altehrwürdiges Gebäude mit zartrosa Anstrich. Mosaikverzierte Steinböden und ein alter Brunnen schmücken das helle Foyer des Theodor-Rothschild-Hauses. Früher war es ein israelitisches Waisenhaus, wie uns Martin Auerbach bei der Begrüßung erklärt.
Jugendhilfe: Wir sind die Ersthelfer im Familienkonflikt

Martin hat einen offenen Blick, eine gelassene Ausstrahlung und ein verschmitztes Lächeln, ein schwäbischer Einschlag schwingt in jedem Satz mit. Bei einem Rundgang zeigt er uns den geräumigen Speisesaal mit Erker, den Veranstaltungsraum, die Kita mit ihren bunt verzierten Fenstern und Türen. Ein Jugendlicher spielt mit einer Mitarbeiterin Mensch-ärgere-dich-nicht am Tisch im Gang, aus dem Speisesaal dringt Kinderlachen herüber. Wir gehen in ein Büro, dessen Mittelpunkt ein Whiteboard ist. Darauf in blauer, roter und grüner Schrift Namen und Alter von Kindern und Jugendlichen, die Martin und seine beiden Kolleginnen betreuen.
ver.di: Du bist bei der Jugendhilfe für Inobhutnahme und Krisenmanagement zuständig – was bedeutet das genau?
Martin Auerbach: Von Inobhutnahme spricht man, wenn der Soziale Dienst Kinder oder minderjährige Jugendliche in einer Notsituation außerhalb des Elternhauses unterbringt. Entweder der Soziale Dienst oder die Polizei erfahren von einer akuten Krise und können es nicht mehr verantworten, dass ein Kind in der Familie bleibt. Oder es funktioniert zu Hause schon länger nicht mehr und die Jugendlichen oder die Eltern bitten beim Jugendamt um Inobhutnahme. Dann werden wir angerufen und versuchen, die Krise gemeinsam mit allen Beteiligten zu lösen. Wir sind also eine Art Notdienst.
ver.di: Was kann eine solche Notsituation denn sein?
Martin Auerbach: Das kann Vernachlässigung im weitesten Sinne sein, Missbrauch, Misshandlung oder eine drohende Zwangsverheiratung. Der Klassiker sind allerdings Konflikte in Patchworkfamilien: Es kommen neue Partner*innen dazu, das Verhältnis zu den Heranwachsenden wird schwieriger. Wenn neue gemeinsame Kinder dazukommen, ist oft die Frage, was aus den jugendlichen Halbgeschwistern wird, die vielleicht nicht zur Schule gehen wollen, Drogen konsumieren oder sonst nicht mehr so richtig ins Schema passen und „an allem schuld“ sind.
Kein Arbeitstag in der Krisenhilfe ist wie der andere

ver.di: Wie sieht ein typischer Tag bei dir aus?
Martin Auerbach: Den gibt es eigentlich nicht, mein Tag ist nicht planbar. Typisch an jedem Tag ist nur, dass ich morgens, wenn ich ins Büro komme, nicht weiß, was mir abends alles widerfahren sein wird. Ist eine Inobhutnahme innerhalb von einer halben Stunde und mit einem Anruf beendet, weil es sich um einen mehr oder weniger normalen Streit zwischen Eltern und Teenager handelt? Oder kommen wir bei einer völlig aufgelösten allein erziehenden Mutter an, deren 15-jähriger Sohn gerade eine Tür eingeschlagen hat, weil er nicht zur Schule gehen will und das deswegen auferlegte Handy-Verbot nicht akzeptiert?
Im Prinzip habe ich mit zwei Kategorien von Jugendlichen tun: Die einen halten es zu Hause nicht mehr aus, bei den anderen hält es das Zuhause nicht mehr aus. Dann suchen wir nach Unterbringungsmöglichkeiten in Wohngruppen, Inobhutnahmefamilien oder anderen Einrichtungen, in der die Jugendlichen für die nächsten vier Wochen bleiben können, bevor wir wissen, ob wir die Wege zueinander wieder ebnen können oder ob die Unterbringung im Heim die bessere Lösung ist. Wir sind eine Art Ersthelfer im Familienkonflikt: Wir versorgen, bis klar ist: Geht’s nach Hause oder ins Heim?
ver.di: Ich nehme an, so etwas passiert nicht nur während der normalen Bürozeiten …
Martin Auerbach: Unser Dienst ist 24 Stunden am Tag für die Polizei und das Jugendamt auf dem Rufbereitschafts-Telefon erreichbar. Abends übernehmen die Kolleg*innen in den stationären Wohngruppen das Telefon. Wenn ein Anruf kommt, dass ein junger Mensch in Obhut genommen werden möchte, versuche ich herauszufinden, was passiert ist und wo das Problem liegt. Ich schaue dann nach Möglichkeiten: Wo gibt es einen freien Platz in einer Wohngruppe? Passt es vom Alter, dem Hintergrund, dem Geschlecht? Oder ist eine Inobhutnahmefamilie die bessere Lösung, wo es ein bisschen ruhiger ist und man individueller agieren kann?
Im nächsten Schritt hole ich den jungen Menschen ab und rede mit ihm. Danach füllt er einen Fragebogen aus, damit wir einen ersten Eindruck bekommen: Warum bin ich in Obhut genommen? Wie erlebe ich die Beziehung zu meinen Eltern? Was müsste sich zu Hause verändern, damit ein Zusammenleben wieder möglich ist? Wie müsste eine Wohngruppe aussehen, damit ich mich wohl fühle? Was erwarte ich vom nächsten Gespräch mit dem Jugendamt?
“Unser Ziel ist die Selbstständigkeit der Jugendlichen”

ver.di: Was passiert in den vier Wochen der Inobhutnahme?
Martin Auerbach: Da passiert ganz viel. Ich beschäftige mich intensiv mit den jungen Menschen und versuche herauszufinden, was sie wollen, wie es zu der Krise kam und wie man das in Zukunft vermeiden kann: Wie viel Betreuung brauchen sie? Müssen wir mit den Eltern, den Eltern des Freundes bzw. der Freundin oder anderen Personen sprechen, um Konflikte zu minimieren? Wurde der oder die Betreffende vielleicht mit Drogen erwischt und die Eltern haben kein Vertrauen mehr? Geht es darum, für die Jugendlichen eine neue Schule zu finden oder mit der alten ins Gespräch zu kommen, damit er oder sie da wieder hingehen kann? Geht es darum, über das Jobcenter ein Praktikum oder eine Ausbildung zu finden, um in einen Beruf zu kommen?
Wir sind quasi die Schnittstelle zwischen allen Beteiligten, wir informieren, vermitteln und beraten. Unser Ziel dabei ist vor allem die Selbstständigkeit der Jugendlichen. Wir schauen, dass der junge Mensch wieder in die Spur kommt und gucken dabei genauer hin: Warum findet er Freunde, die ihm nicht gut tun, und keine anderen? Wie macht man ihm begreiflich, dass er morgens aufstehen und zur Schule gehen muss, wenn er wirklich eine Ausbildung haben will? Wir versuchen aber auch, die Eltern absprachefähig zu machen und erklären ihnen: Es ist völlig normal, dass ein Mensch von 16, 17 Jahren nach außen drängt und etwas mit Gleichaltrigen machen will – ihn in eine 200 Kilometer entfernte Einrichtung zu stecken, ist nicht die Lösung.
Mehr Bedarf an Krisenhilfe durch soziale Schere

ver.di: Das klingt nach einer komplexen und herausfordernden Aufgabe … Wie viele Kinder und Jugendliche nehmt ihr in Obhut?
Martin Auerbach: Wir versorgen zwischen 80 und 120 junge Menschen pro Jahr. Normalerweise haben wir ein bis zwei Neuaufnahmen pro Woche, aber manchmal kommen in einer Woche auch fünf bis zehn Kinder und Jugendliche zu uns. Wir sind ein „Saisongeschäft“: In den Familien gibt es mehr Konflikte, wenn zum Beispiel die Zeugnisvergabe ansteht oder die Versetzung gefährdet ist. Oder wenn die Jugendlichen im Frühling nach mehr Freiheit streben und abends nicht nach Hause wollen, wenn sie sollen … Seit 2010 sind wir nur noch für den halben Landkreis zuständig und trotzdem sind es nicht weniger Kinder geworden – die Anzahl der Inobhutnahmen steigt also generell an.
ver.di: Woran liegt das deiner Meinung nach?
Martin Auerbach: Heute ist die finanzielle Situation für Familien schwieriger als früher. In den Achtzigern konnte eine arbeitende Person die Familie versorgen und es hat noch für einen Urlaub gereicht. Heute müssen beide Elternteile hart arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. In den letzten Jahren ist bei den Beschäftigten kaum etwas angekommen, immer mehr sind prekär beschäftigt und drohen aus der Verwertungsspirale rauszufallen. Die wenigsten haben ein dickes Bankkonto, mit dem sie die nächste Krise locker überstehen könnten. Und das in einer Zeit, in der Jugendliche Ansprüche haben – Smartphone, Führerschein, Auto …
Mein Traumjob Krisenhilfe: Man braucht Ausdauer und ein dickes Fell

ver.di: Du bist gelernter Jugend- und Heimerzieher – wie kamst du zu deinem Beruf?
Martin Auerbach: Schon während meiner Schulzeit war ich im Jugendrotkreuz aktiv. Für mich war von Anfang klar, dass ich etwas mit Menschen machen wollte. Die Arbeit mit Jugendlichen fand ich von den sozialen Berufen am interessantesten – die Jugend ist eine spannende Zeit, in der ganz viel passiert. Es war ja damals altersmäßig auch nicht weit weg von mir selbst. Durch meine eigene angeborene Abneigung gegen Autoritäten kann ich mich bis heute gut in die Jugendlichen hineinversetzen. (lacht)
Ich habe mich dann für die Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher beim Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands entschieden. Meinen Zivildienst habe ich am Staatlichen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum in Nürtingen angefangen und bin dann zur Stiftung Jugendhilfe aktiv gewechselt. Seit 1999 bin ich hier fest angestellt.
ver.di: Wow, das ist ja eine ganze Weile. Worauf legst du bei deiner Arbeit besonderen Wert?
Martin Auerbach: Mir ist bei meiner Arbeit Nachhaltigkeit wichtig. Gerade weil wir die Kinder und Jugendlichen in der Inobhutnahme nur über einen kurzen Zeitraum betreuen. Es ist klar, dass sie in dieser kurzen Zeit, in der sie bei uns sind, oft noch nicht alles umsetzen können, worüber wir reden. Aber wenn sie schon mal verstanden haben, dass es sinnvoll ist, das eine zu tun oder das andere zu lassen, ist es eine gute Basis, damit sich das im Laufe der Zeit und mit mehreren Anstößen verfestigt.
Wenn ich merke, dass ich bei jemandem nicht durchdringe, dann sage ich ihm oder ihr: “Okay, du kannst mir gerade nicht zuhören. Wenn sich das ändert, komm wieder, ich bin da!” Man braucht für meine Arbeit Ausdauer und Geduld und darf es nicht persönlich nehmen, wenn andere ihre Unzufriedenheit an einem auslassen.
ver.di: Das ist nicht immer der dankbarste Job …
Martin Auerbach: Stimmt, eine gewisse Gelassenheit muss man schon mitbringen. Dafür mag ich die Abwechslung an meinem Job sehr. Und wenn ich merke, dass ich den Jugendlichen wirklich helfen konnte, ist das ein tolles Gefühl. Manchmal treffe ich ehemalige Schützlinge in der Stadt. Es ist schön, wenn die sich freuen mich zu sehen, und ich höre, dass sie in Arbeit sind, sich wohlfühlen, es hinbekommen, Beziehungen dauerhaft zu leben, und mit dem, was sie haben, zufrieden sind.
Einen meiner Jugendlichen habe ich auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt wiedergetroffen. Er war im Dezember 2015 zu uns gekommen, als wir eine Notaufnahme für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge eingerichtet hatten. Damals sind wir wie jedes Jahr im Dezember mit Kollegen und Jugendlichen auf den Weihnachtsmarkt gegangen und er war total begeistert von dem Treiben. Wir konnten ihm später eine Saisonarbeit dort vermitteln. Als wir das nächste Jahr wieder mit der Gruppe da waren, hat er an einem Stand Gebäck verkauft und uns schon von weitem angestrahlt.
Jugendhilfe war früher näher am Jugendlichen

ver.di: Du hattest im Dezember 20-jähriges Dienstjubiläum – wie hat sich deine Arbeit im Laufe der Zeit verändert?
Martin Auerbach: Bis 2009 gab es eine vollstationäre Inobhutnahme-Wohngruppe mit vier Plätzen, in der wir die Jugendlichen rund um die Uhr betreut haben. Wenn sie von der Schule kamen, haben wir gemeinsam Mittag gegessen und konnten vieles anschließend beim Geschirrspülen klären. 2010 hat sich unser Inobhutnahme-Konzept verändert und ambulantisiert – jetzt sind wir drei Mitarbeiter*innen, die sich ambulant um die Jugendlichen kümmern. Wenn ich mit jemandem sprechen will, rufe ich in der Wohngruppe an, frage an, ob der Jugendliche da ist, setze mich ihm ganz offiziell gegenüber an einen Tisch und spreche mit ihm unter dem Nimbus der Sozialarbeit und mit ganz viel face to face …
ver.di: Ich höre eine gewisse Ironie heraus … Vermisst du die Arbeit in der Wohngruppe?
Martin Auerbach: Ich habe meiner Tätigkeit in der stationären Jugendhilfe schon so manche Träne nachgeweint. Es ist etwas anderes, wenn du Tag und Nacht mit den Jugendlichen zusammen bist. Das ist zwar stressiger, weil du ihnen mehr Regeln aufdrücken und mehr Sachen thematisieren musst – wir benutzen schließlich dieselben Töpfe, sowohl in der Küche als auch im Bad –, aber es ist auch lebendiger und man kann mehr bewirken.
Sparmaßnahmen in der Jugendhilfe gefährden Jugendliche und Familien

ver.di: Wie siehst du den generellen Trend zur Ambulantisierung der sozialen Arbeit?
Martin Auerbach: Während vor drei, vier Jahrzehnten ein Kind schneller in Obhut genommen und im Heim untergebracht wurde, versucht man es heute aus Kostengründen zuerst mit niedrigschwelligen ambulanten Maßnahmen. Klar, vieles kann man auch zu Hause mit Wohlwollen regeln und die Kinder können in ihrer Umgebung bleiben. Aber diese Einsparungsmaßnahmen haben Nachteile. Heute wird oft viel zu lange gewartet, bis man einen jungen Menschen aus dem Familiensystem rausnimmt. Das verzögert sich teilweise drei, vier, fünf Jahre. Erst wenn alle niedrigschwelligen Maßnahmen gescheitert sind und die Situation schließlich eskaliert, denkt man langsam über Heimunterbringung nach. Dann haben wir aber zu wenig Spielraum in der sozialen Arbeit. Die Jugendlichen haben dann schon mehrere Stationen hinter sich, bei denen sie gelernt hat, dass sie sich nicht an Regeln halten müssen. Außerdem haben sie schon ganz viele Beziehungsabbrüche in der Betreuung erlebt. Manche sind so außer Rand und Band, dass man über eine geschlossene Einrichtung nachdenken muss, damit sie sich nicht entziehen können.
ver.di: Das klingt problematisch. Wie sähe deine Arbeit in einer idealen Welt aus?
Martin Auerbach: In einer idealen Welt bräuchte es keine Jugendhilfe und ich wäre arbeitslos! (lacht) Jetzt im Ernst: Meiner Meinung nach ist der Neoliberalismus das Problem. Es muss ein Umdenken stattfinden, was soziale Arbeit betrifft. Erziehung kostet erst mal und bringt erst mal keinen Ertrag, aber die Nicht-Erziehung kostet später sehr viel mehr, wenn Jugendliche zum Beispiel straffällig werden. Wir müssen uns überlegen: Warten wir, bis der Jugendrichter eine Entscheidung trifft, oder tun wir etwas, bevor es dazu kommt?
Jugendhilfe funktioniert nicht nach Kassenlage
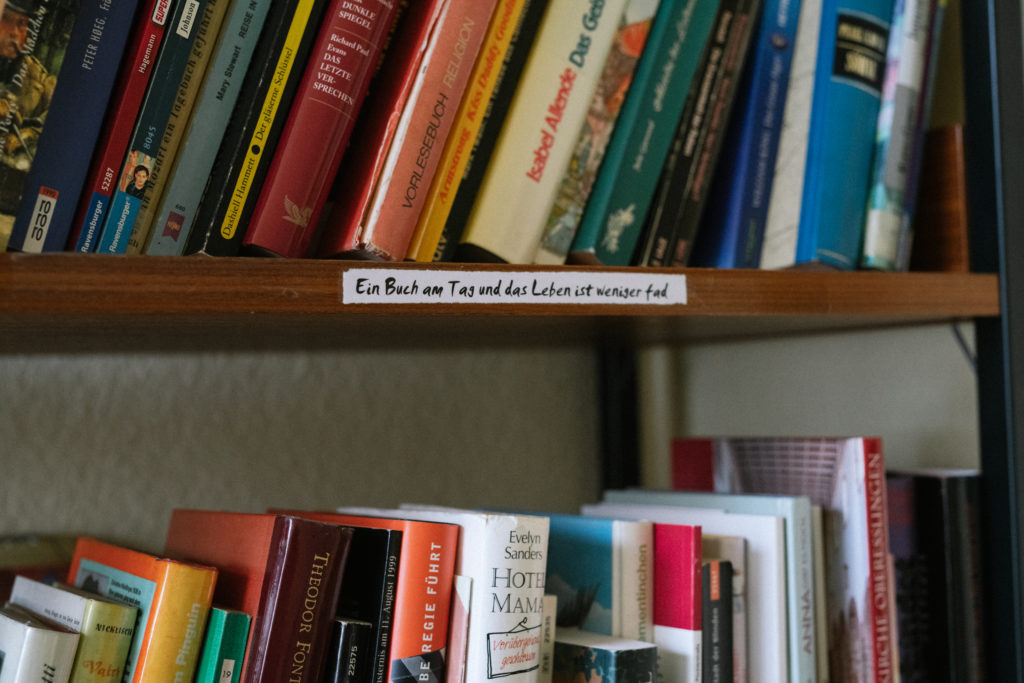
ver.di: Was könnte man deiner Meinung nach dafür tun, damit sich die Situation verbessert?
Martin Auerbach: Der Staat müsste die Daseinsvorsorge in dem Bereich stärker ausgestalten. Wir bräuchten mehr Geld im System, um Menschen vernünftige Bildungsbiografien zu ermöglichen, die zu Erwerbstätigkeit und Selbstständigkeit führen statt zu Abgehängtsein. Wir wären nicht darauf angewiesen, Hilfe nach Kassenlage zu gewähren und gezwungen, aus einem Katalog die Maßnahmen auszusuchen, die günstig und frei sind, wie das in der Behindertenhilfe seit Neuestem der Fall ist. Und natürlich müsste man das Fachpersonal entlasten.
ver.di: Ich verstehe. Vielleicht erst mal zur Qualität der Arbeit: Was müsste stattdessen der Ansatzpunkt euer Arbeit sein?
Martin Auerbach: Wir sollten vom jeweiligen Menschen ausgehen: Was braucht dieser Jugendliche und worauf kann er sich einlassen? Wie kriege ich eine Maßnahme kreiert, die diese Bedürfnisse abdecken kann? Wir brauchen mehr Projekte und mehr individuelle Maßnahmen, damit man sich mehr mit dem Einzelnen auseinandersetzen kann. Früher gab es Auslandsaufenthalte, bei denen man intensiv mit den Jugendlichen arbeiten konnte. Heute macht man das nur noch bei schweren Fällen wie Intensivtätern. Denn individuelle Förderung kostet Geld.
Soziale Arbeit: Mehr Qualität in der Betreuung braucht gute Arbeitsbedingungen und mehr Leute

ver.di: Braucht es dafür nicht auch mehr Personal, das in der sozialen Arbeit knapp ist?
Martin Auerbach: Natürlich, durch die knappe Personalbemessung sinkt die Qualität der Arbeit, da kann der oder die Einzelne gar nichts für. Wir haben zum Beispiel in unseren stationären Wohngruppen Allein-Dienste, da sinkt natürlich die Qualität notgedrungen. Gäbe es mehr Doppeldienste, könnte man sich den Jugendlichen viel individueller widmen.
In vielen Einrichtungen gibt es eine hohe Fluktuation. Als Mitarbeitervertreter setze ich mich dafür ein, dass sich unsere Mitarbeiter*innen hier wohlfühlen und bleiben. Nur so kann man die Kontinuität gewährleisten, die den Jugendlichen die Sicherheit gibt, die sie brauchen. Wenn du ständig neue Mitarbeiter-Teams hast, müssen die sich immer erst zurechtfinden und sich überlegen, wie sie mit der Situation umgehen. Im schlimmsten Fall ist der Jugendliche länger da als die Kolleg*innen, dann macht er die Regeln und nutzt die Unsicherheit der anderen für sich.
ver.di: Und wie hoch ist der Druck bei euch, zum Beispiel wenn die Kolleginnen krank werden?
Martin Auerbach: Wie ist es bei uns, wenn jemand krank ist …? Revolutionäre werden nicht krank (lacht). Aber mal im Ernst: Wir vertreten uns gegenseitig und priorisieren unsere Aufgaben selber. Abstrakt kann man es so beschreiben: Unsere Tätigkeit ist ein atmendes System – im Normalbetrieb atmen wir ruhig und tief in den Bauch, wenn mehr anfällt, schneller und etwas flacher und bei Engpässen hecheln wir, um allen gerecht zu werden. Allerdings kriegen wir das hier insgesamt ganz gut hin. Aber ich weiß, dass das eher die Ausnahme als die Regel ist und ich kenne natürlich auch andere Beispiele.
Eine gute Freundin von mir ist gelernte Heilerziehungspflegerin in der Behindertenhilfe. Sie hat zwölf Jahre eine stationäre Wohngruppe betreut. Die Arbeitsbedingungen waren so schlimm, dass sie irgendwann hingeschmissen hat. Der Druck wurde einfach zu groß: nie zu wissen, ob man wirklich frei hat. Dass sie nichts planen konnte. Dann die Angst, unter dem Druck und der hohen Belastung etwas falsch zu machen, was den Klienten schaden könnte. Das kriegt man dann auch in der Freizeit nicht aus dem Kopf. Das geht dann irgendwann einfach nicht mehr.
Sie arbeitet heute in der Gastronomie. Sie hat zwei Jobs und es ist sicher auch ziemlich stressig, aber sie sagt, sie habe weniger Druck und vor allem: Wenn sie frei hat, hat sie frei und denkt nicht über Arbeit nach. Solche Geschichten höre ich viele: von guten Leuten, die darüber nachdenken hinzuwerfen, weil sie nicht mehr können.
ver.di: Aber ist es denn finanziell eine Einschränkung?
Martin Auerbach: Mit den beiden Jobs und dem Trinkgeld ist es wohl in etwa vergleichbar.
Am Tisch mit dem Arbeitgeber: Mitbestimmung heißt mitgestalten

verdi: Du engagierst dich nicht nur seit vielen Jahren bei ver.di, sondern bist auch Mitarbeitervertretungs-Vorsitzender und Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen Werk Württemberg. Wie kamst du dazu und was konntet ihr an Verbesserungen erreichen?
Martin Auerbach: Als sich 2004 die Fusion des vorherigen Vereins mit der Stiftung Jugendhilfe abzeichnete, wollte ich lieber mit am Tisch sitzen und mitbestimmen. Wir haben es geschafft, dass alle Kolleg*innen übernommen wurden. Außerdem haben wir unseren Arbeitgeber von der Bezahlung nach Tarif überzeugt – seit 2014 gilt bei uns der SuE-TVöD eins zu eins. Letztendlich weiß unser Arbeitgeber auch, dass für ihn als Einrichtung die Spielräume größer werden, wenn die Beschäftigten besser bezahlt sind. Als für die Schulbegleitung eine neue gGmbH gegründet wurde, konnten wir die Arbeitsbedingungen mitgestalten. Auch dort gelten die Tarifbedingungen des öffentlichen Dienstes und unsere Fortbildungsregelung.
Mittlerweile bin ich zu 40 Prozent für meine Arbeit in der Mitarbeiter*innenvertretung freigestellt – ich bin sehr dankbar, dass meine beiden Kolleginnen mein Engagement mittragen.
ver.di: Das klingt ja alles ganz gut. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter*innen bei euch?
Martin Auerbach: Ich muss schon sagen: Bei der Stiftung Jugendhilfe aktiv haben wir ein sehr gutes Modell. Wir haben viele Freiräume und können selbstständig Entscheidungen treffen, über die wir unseren nächsten Vorgesetzten nur informieren. Auf der anderen Seite weiß ich auch die Rückendeckung zu schätzen; selbst wenn ich einen Fehler machen würde, wüsste ich, dass mein Vorgesetzter mir den Rücken stärken würde. Dieses Vertrauensverhältnis ist durch nichts zu ersetzen.
Auf der höheren Ebene haben wir die Diakonie-Dienstgemeinschaft – wir reden mit unserem Arbeitgeber auf Augenhöhe. Das wird in unserer Einrichtung gelebt. Wir werden in viele Entscheidungsprozesse miteinbezogen und gucken gemeinsam, dass wir für die Kolleg*innen das Beste herausholen, Hand in Hand. Ich weiß, dass ich sehr privilegiert bin, was meinen Arbeitgeber angeht. Das geht längst nicht allen in der Jugendhilfe so.
Gute Arbeitsbedingungen sind auch für Arbeitgeber gut
ver.di: Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, braucht es gute Arbeitsbedingungen. Wie handhabt ihr das in der Stiftung Jugendhilfe aktiv?
Martin Auerbach: Die Bezahlung nach Tarif ist ein wichtiger Faktor. Wenn mein Arbeitgeber im Großraum Stuttgart Lohndumping betreiben würde, bekämen wir keine Kolleg*innen. Aber wir stehen gut da: Wir haben zum Beispiel eine sehr gute Fortbildungsregelung hier. Allen Beschäftigten stehen fünf Tage und 300 Euro im Jahr für Fortbildung zur Verfügung. An unserem eigenen Fortbildungsinstitut zahlen unsere Mitarbeiter*innen nur den halben Preis. Das Angebot wird sehr gut angenommen. Die Jugendhilfe ist von den Weiterbildungsmöglichkeiten her sowieso besser gestellt, weil sie mit ganz viel Fachpersonal funktioniert. Nur bei den Schulbegleitungen haben wir ungelernte Fachkräfte oder Quereinsteiger. Im Unterschied zur Altenhilfe mit einer Fachkraftquote von nur 50 Prozent.
Alles in allem weiß unser Träger, dass er durch gute Arbeitsbedingungen für Beschäftigte attraktiv bleibt. Von einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen im sozialen Bereich profitieren also alle Seiten, Mitarbeiter*innen, Arbeitgeber und vor allem die Jugendlichen.
ver.di: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke für den spannenden Einblick in deine Arbeit, Martin, und dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast!
Das Gespräch für ver.di führte Nadine Landeck. Alle Bilder in diesem Porträt sind von Kerstin Müller.

